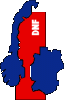In Norwegen längere Distanzen zu überwinden ist nicht immer so einfach: Die inländische Bahnstrecke endet in Bodø, Straßenverbindungen entsprechen in vieler Hinsicht nicht den europäischen Standards.
Allerdings hat das Land ein enges Netz von Flugplätzen, Nord-Norwegen kann regelrecht als Flugplatz-Eldorado bezeichnet werden. Fliegen würde sich also als das Mittel der Wahl anbieten, ist aber wegen seiner unschönen CO2-Bilanz ins Gerede gekommen.
Zu Land und zu Wasser hat Norwegen bereits eine ansehnliche Flotte von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen: Die Neuzulassungen von Elektro-Autos sind dort so groß wie nirgendwo sonst, Inlandsfähren werden in den nächsten Jahren völlig ohne Verbrenner-Motoren auskommen. Was liegt also näher als eine ähnliche Umstellung auch bei Flugzeugen anzustreben?
Der Verwaltungsdirektor von Widerøe, Stein Nilsen, ist überzeugt, dass sich diese Utopie in 5 – 6 Jahren als Realität erweisen wird. Angst, dass der Vorrat an elektrischer Energie nicht bis zum Ziel ausreichet („Reichweitenangst“) muss man wegen der kurzen Strecken zwischen den einzelnen Flugplätzen nicht haben, eine Ausstattung mit Hybridtechnologie (zusätzlich Benzin, Wasserstoff, Propan o.ä.) kann sie ganz verhindern. Die Flugzeuge könnten zunächst mit 9 – 11 Sitzen ausgestattet werden, bis 2030 könnten es über 40 Plätze werden. Die größte Herausforderung für elektrische Flugzeuge ist zur Zeit noch das Gewicht. Um die gleiche Menge Energie zu transportieren wie 1 kg Flugbenzin, braucht man eine Batterie von ca. 40 kg; allerdings ist ein Elektromotor zwei- bis dreimal effektiver als ein Benzinmotor.
Der Ehrgeiz von Avinor (der norwegischen Flugsicherung) und der Luftfahrtsbehörde ist es, den ganzen innernorwegischen Flugverkehr bis 2040 auf Elektro- oder Hybrid-Antrieb umgestellt zu haben.
Das Flugzeug könnte so auf längere Sicht zum Kollektivtransportmittel werden und Busse ersetzen.